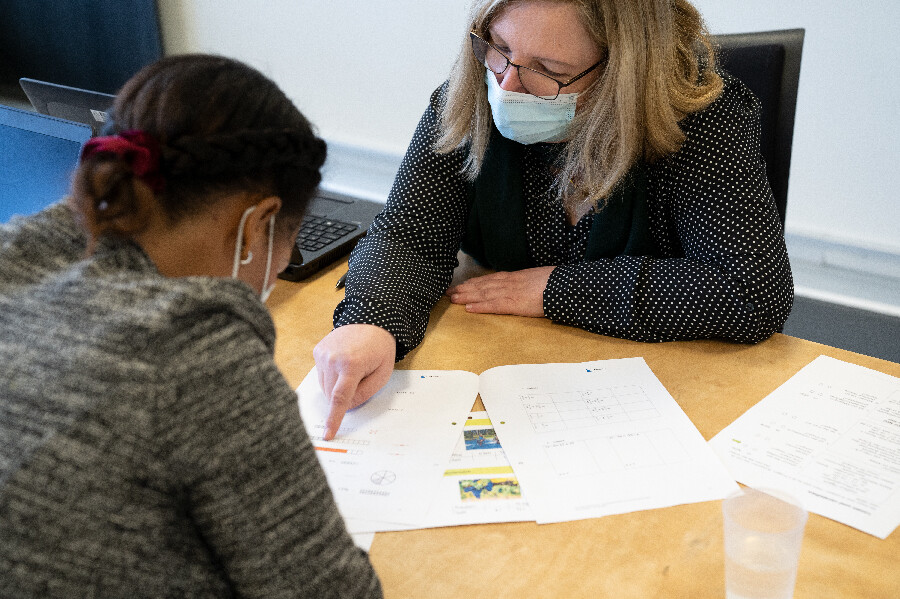Der Weg in die Sozialhilfe muss nicht unbedingt eine Sackgasse sein – Lernstandserhebungen klären bei Betroffenen den Weiterbildungsbedarf und unterstützen sie so auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt.
Etwa die Hälfte der Personen, die Sozialhilfe beantragen, verfügen über nur unzureichende Grundkompetenzen. Mitarbeitende in Sozialämtern oder Fachstellen Arbeitsintegration können neu mit einer sogenannten Lernstandserhebung abklären lassen, in welchen Bereichen sich direkt Betroffene weiterbilden sollten, damit sie sich gut vorbereitet bei einer neuen Stelle vorstellen können. Doch wie laufen diese Art von Abklärungen ab? Welche Themen werden geprüft? Und wie werden die daraus gewonnenen Empfehlungen umgesetzt?
Ablauf und Themen einer Abklärung
Doris Züger ist Expertin für Lernstandserhebungen an der EB Zürich. Vor der eigentlichen Abklärung bittet sie die Teilnehmenden per E-Mail um ein paar schriftliche Informationen über sich selbst. Die Mailantworten liefern ihr bereits erste Hinweise, welche Erfahrungen die Person mit IKT oder im Umgang mit der deutschen Sprache hat. Bei Bedarf greift sie selbst zum Handy, schickt eine SMS oder ruft direkt an.
Quote
«Ausgehend von der Selbsteinschätzung und meinen ersten Eindrücken beginne ich jeweils mit einer Aufgabe, schaue, wie es läuft, und fahre mit einer einfacheren oder einer schwierigeren fort.»
Zu Beginn der ca. einstündigen Abklärung bespricht Frau Züger nochmals kurz den Grund des Treffens. Anschliessend erzählt die Person etwas über ihren schulischen Werdegang, ihre berufliche Situation und ihre Stärken und Schwächen. Dabei muss sie selbst ihre eigenen Kompetenzen in Deutsch, IKT und Mathematik einschätzen. Dann beginnt der eigentliche Test aus verschiedenen Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. «Ausgehend von der Selbsteinschätzung und meinen ersten Eindrücken beginne ich jeweils mit einer Aufgabe, schaue, wie es läuft, und fahre mit einer einfacheren oder einer schwierigeren fort», erklärt Frau Züger ihr Vorgehen. Dabei prüft sie alle drei Themenbereiche der Grundkompetenzen:
- Deutsch: Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben – in der Regel Niveau A1 bis B1, max. bis B2
- IKT: der alltägliche Umgang mit Smartphone, PC oder Apps für die Kommunikation und Informationsbeschaffung
- Mathematik: alltägliche Berechnungen von Preisen oder Rabatten, die aus der Schule bekannten vier Grundrechenarten sowie Kopfrechnen und schriftliches Rechnen
Das Ergebnis hält Frau Züger in einem Abschlussbericht fest. Dieser enthält den Lernstand in den drei abgeklärten Themengebieten, ihren Eindruck zur Problemlösungskompetenz sowie zur Motivation und Einstellung des Prüflings. Der Bericht spricht auch Empfehlungen zu möglichen Weiterbildungen aus. Diesen leitet sie an die verantwortliche Stelle weiter: im vorliegenden Fall an die Fachstelle Arbeitsintegration in Dietikon.
Umsetzung der empfohlenen Massnahmen
Diese fundierte Rückmeldung und die darin enthaltenen Empfehlungen dienen der Behörde dazu, für Personen mit fehlenden Grundkompetenzen geeignete, meist niederschwellige Kurse zu suchen. Die Bezieher/innen von Sozialhilfe werden von der Fachstelle über die Empfehlungen informiert und dazu angehalten, ihre Notlage z.B. in einem ersten Schritt mit einem Kursbesuch zu lindern. Der Behörde liegt daran, dass bei den Betreuten eine Basis an Grundkompetenzen geschaffen wird. Denn Ziel ist, möglichst eine persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen und eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu finden.

Quote
«Aus Sicht der Arbeitsintegration ist der genaue Wissenstand unserer Klientinnen und Klienten wesentlich, wenn sie Arbeitgebenden vorgeschlagen werden.»
Neben der Existenzsicherung hat die Sozialhilfe auch die Aufgabe, persönliche Hilfe zu leisten und Sozialhilfebeziehende in ihrer Integration zu fördern. Die Fallführenden und die Beratenden der Fachstelle Arbeitsintegration sind deshalb in ständigem Kontakt mit ihnen, auch während der Zeit ihrer Kursbesuche. Das Erlernen der Grundkompetenzen ist ein erster Schritt in Richtung Integration. Gleichzeitig geht es aber auch darum, weitere Schritte zu planen.
Wie wichtig es ist, einen ‚Sozialfall‘ frühzeitig und richtig aufzugleisen, unterstreicht Attila Stanelle, Leiter Fachstelle Arbeitsintegration der Stadt Dietikon. Er ist überzeugt vom Mehrwert dieser Abklärungen. «Aus Sicht der Arbeitsintegration ist der genaue Wissenstand unserer Klientinnen und Klienten wesentlich, wenn sie Arbeitgebenden vorgeschlagen werden. Erst bei einem Kurs oder Vorstellungsgespräch festzustellen, dass beispielsweise Schreibkenntnisse den Anforderungen nicht genügen, wäre zu spät.»
Über die SKOS zueinander gefunden
Dass sich die Fachstelle Arbeitsintegration wegen Lernstandserhebungen an die EB Zürich wandte, geht auf die SKOS-Weiterbildungsoffensive (WBO) zurück: Expertinnen und Experten haben die beiden Institutionen miteinander vernetzt.
Zusammen mit Frau Kindler-Scaltri, Leiterin Fachstelle Grundkompetenzen der EB Zürich, erarbeitete Herr Stanelle ein erstes Pilotprojekt «Lernstandserhebung». Fünf Sozialhilfebeziehende nahmen daran teil und durchliefen eineinhalbstündige Standortbestimmungen. Nach diesem Testlauf wurde die Abklärung inhaltlich weiter justiert und zielorientierter gestaltet und kann nun bei Abklärungen zu Grundkompetenzen eingesetzt werden. «Das war eine tolle Zusammenarbeit mit insgesamt guten Ergebnissen. Entstanden ist ein Gesamtkonzept für die Dietiker Sozialabteilung, bei der die Standortbestimmung ein zentrale Rolle einnimmt», fasst der Leiter der Fachstelle seine Zusammenarbeit mit der EB Zürich zusammen.